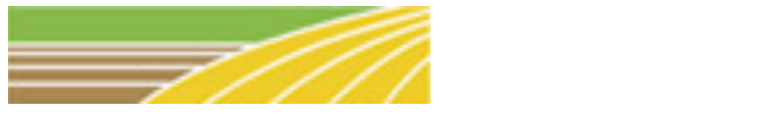GVS Praxisabend von Düsen, Verteilung, Abdrift und Weiterbildung in Sachen Pflanzenschutz.
GVS-Praxisabend bei Patrik Eicher im Bodental bei Basadingen
Vor Kurzem stand der GVS-Praxisabend auf dem Terminkalender vieler Bauernfamilien. Jedes Jahr widmet sich der GVS einem Schwerpunktthema – dieses Jahr dreht sich alles um Düsen, Verteilung, Abdrift und Weiterbildung in Sachen Pflanzenschutz.
Rund 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich in Basadingen ein, um sich über die neusten Entwicklungen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu informieren. Statt wie geplant unter freiem Himmel, mussten die Tische und Bänke aufgrund des Wetters in die offene Scheune verlegt werden – der Stimmung tat das keinen Abbruch.
Digitalisierte Fachbewilligung Pflanzenschutz (FaBe)
Den Auftakt machte Lena Heinzer vom Landwirtschaftsamt Schaffhausen mit einem praxisnahen Vortrag zur digitalen Fachbewilligung Pflanzenschutz (FaBe). Im ersten Halbjahr 2026 muss die bisherige Bewilligung durch die digitale ersetzt werden – ein Schritt, der Teil der Weiterentwicklung der Vorschriften rund um den Einsatz von PSM ist.
Die Umstellung läuft einfach ab:
Das entsprechende Formular kann auf permis-pph.admin.ch ausgefüllt werden.
Nachweise wie ID und alte FaBe oder ein anerkannter Ausbildungsabschluss werden hochgeladen.
Nach etwa einem Monat erfolgt die Validierung, danach wird eine Rechnung versandt.
Nach Zahlungseingang wird die neue FaBe freigeschaltet.
Am besten wird die neue Bewilligung als App aufs Smartphone geladen – so kann sie jederzeit vorgewiesen werden.
Wichtig: Ab dem 1. Januar 2027 können Pflanzenschutzmittel für den beruflichen Einsatz nur noch mit einer gültigen digitalen FaBe gekauft werden! Personen ohne FaBe können also nur noch anwendungsfertige, explizit für den Privatgebrauch zugelassene PSM kaufen. Damit sollen umweltschädigende Anwendungsfehler im Privatbereich vermieden werden.
Lena Heinzer betonte ausserdem: Ab 2027 ist eine regelmässige Weiterbildung Pflicht. Wer die Weiterbildung innert der vorgegebenen Frist versäumt, verliert die FaBe. Eine FaBe pro Betrieb genügt – so kann auch ein Lehrmeister seine Lernenden unterrichten.
Hinweis zur Anerkennung von Abschlüssen:
Anerkannt: Landwirt EFZ, Meisterlandwirt, Winzer EFZ
Weiterbildungszyklen beginnen ab 01.01.2027 – genaue Fristen je nach Abschlussjahr
Applikationstechnik im Fokus
Im Anschluss sprach Benedikt Kramer von AGRIDEA über die Herausforderungen und Chancen moderner Applikationstechnik. Er war massgeblich an der Erstellung des Merkblatts zu Abdrift und Abschwemmung beteiligt. Denn: Der PSM-Aktionsplan ist für die Landwirtschaft verbindlich.
Fachwissen ist entscheidend – bei der Wirksamkeit genauso wie bei der Anwendung.
Seit dem 1. Januar 2025 gelten im ÖLN neue Auflagen zur Abdrift. Die Regeln zur Abschwemmung sind ebenfalls in Kraft. Viele Informationen dazu finden sich auf agripedia.ch.
Massnahmen zur Reduktion der Abdrift im Feldbau (Auszug)
Beispielhafte Massnahmen und zugehörige Abdriftpunkte:
Antidriftdüsen (AD-Düsen): verringerter Feintropfenanteil verringert die Abdrift, Abdrift-Punkte nach Tabelle des Julius-Kühn-Institut (0.5 Punkte für 50 % bis 3 Punkte für 95 %)
Injektordüsen (ID-Düsen): ebenfalls geringerer Feintropfenanteil, vereinfachtes System für 1 Punkt beim Einsatz mit maximal 3 bar und 2 Punkten bei maximal 2 bar.
Vegetationsstreifen von mindestens 3 m Breite für 1 Punkt
Einzelpflanzenbehandlung mit Kameraerkennung und vollständiger Abschirmung (z.B. der ARA von Ecorobotix) für 3 Punkt
Weitere Einflussfaktoren:
Wind: ab 6 km/h erhöhte Abdrift; ab 20 km/h ist die Ausbringung verboten
Tropfengrösse: grössere Tropfen = geringere Abdrift
Fahrgeschwindigkeit: max. 8 km/h empfohlen Fahrgeschwindigkeit der Düse und dem gewünschten Druck, (Tropfenspektrum) anpassen.
Balkenabstand: maximal 50 cm über der Kultur
Temperatur: optimal zwischen 8 und 25 °C
Tageszeit: bevorzugt frühmorgens oder abends
Blattfeuchtigkeit: nur trockenes Blattwerk behandeln
Luftfeuchtigkeit: optimal zwischen 60 % und 95 %
Praxisbericht von Gastgeber Patrik Eicher
Patrik Eicher zeigte praxisnah, wie wichtig die richtige Düse für eine zielgenaue Verteilung ist.
«Was wir hier immer wieder hören: Es darf mit diesen Mitteln nichts passieren. Und genau das ist der Knackpunkt. Die PSM korrekt anzuwenden und dabei sämtliche Vorschriften einzuhalten, braucht Wissen – denn einfach ist das nicht.»
Er riet dazu, sich rechtzeitig auf die neuen Vorschriften vorzubereiten – etwa durch eine Beratung bei Edi Müller über den Schaffhauser Bauernverband.
Ein zentrales Thema war der sogenannte Mittlere Volumetrische Durchmesser (MVD):
Kleine, senkrechte Zielfläche, Windstille: → kleinerer MVD (ca. 200–300 µm)
Tiefliegende Zielbereiche, höhere Temperaturen, Wind: → grösserer MVD (300–400 µm)
«Diese Tropfen sind wirklich sehr klein – ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter.»
Auch das Tropfenspektrum und die Gradeinstellung spielen eine Rolle. Eicher empfahl die App «Lechler Agrar», um die passende Düse auszuwählen.
«Ihr müsst wissen, was für eine Düse ihr auf eurer Spritze habt – das ist entscheidend, um hohen Wirkungsgrad und Vorgaben unter einen Hut bringen zu können.»
Keramikdüsen sind langlebiger, aber nicht automatisch besser. Es gilt: Die Düse muss zur jeweiligen Anwendung passen.
Highlight: Der fluoreszierende Feldversuch
Nach Einbruch der Dunkelheit verschob sich die Veranstaltung auf ein nahegelegenes Weizenfeld. Dort wurde eine fluoreszierende Flüssigkeit zuerst mit 200 Liter, danach mit 400 Liter pro Hektar ausgebracht.
Mit UV-Taschenlampen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Effekt der verschiedenen Ausbringungsmengen direkt beobachten. Im Schwarzlicht leuchteten die Pflanzen violett – ein eindrucksvolles Bild.
Benedikt Kramer erklärte: «Für mich ist dieser Abend ein optimaler Test. Zukünftig möchte ich die fluoreszierende Flüssigkeit in den AGRIDEA-Weiterbildungen einsetzen, um die Unterschiede noch besser aufzeigen zu können.»
Bild 1 und Video:
200 Liter pro Hektar
Hier wurde mit 200 Litern pro Hektar gespritzt.
Die fluoreszierende Flüssigkeit wurde in geringer Menge auf den Weizen ausgebracht – gut sichtbar unter UV-Licht: Die Benetzung der Pflanzen ist eher punktuell. Vor allem in tieferliegenden Blattetagen zeigen sich kleinere, weniger intensive Leuchtflächen. Dieser Versuch zeigt eindrücklich, wie sich die Flüssigkeitsmenge auf die Verteilung der Tropfen auswirkt – weniger Flüssigkeit bedeutet oft auch weniger gleichmässige Abdeckung, besonders in dichten Beständen oder bei windigen Bedingungen.
Bild 2:
Hier wurde mit 400 Litern pro Hektar gespritzt.
Bei doppelter Ausbringungsmenge ist die Leuchtintensität deutlich höher – das UV-Licht macht die flächige Benetzung sichtbar. Die fluoreszierende Flüssigkeit erreicht selbst die unteren Blattbereiche deutlich besser. Der Versuch zeigt: Mit zunehmender Wassermenge steigt auch die Zielgenauigkeit, insbesondere bei komplexer Vegetation. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, wie wichtig die richtige Düsentechnik ist, um eine gleichmässige Verteilung zu erzielen – unabhängig von der verwendeten Literzahl.